Städteinitiative und Verkehrsminister fordern Freiheit für T-30 als städtische Norm
Die Auto-orientierten Verkehrsgesetze (->
DUH) behindern die Mobilitätswende; absurdes Beispiel durch die Stadt (Amt 66): Auf dem „Weg nach den Hingbenden“ sei T-30 laut StVO nur für 100 m erlaubt, der Weg aber 400 m lang. Die StVO basiert auf dem
absoluten Vorrang des Autos, verhindert T-30 als städtische Norm und autofreie Zonen (->
Spiegel). Wir meinen: Kein Vorrang für „flüssigen Verkehr“ (StVO, §45), sondern „Mobilität mit möglichst wenig Verkehr“ (
klimareporter). Derzeit (0 4/24)fordern 1068
Kommunen (152 in NRW) der Initiative „
lebenswerte Städte“ eine Verkehrsrechts-Reform, um auf kommunaler Ebene frei über Verkehrsplanung zu entscheiden. Aber die CDU stoppte eine – zudem
unzureichende! –
Reform im Bundesrat (->
Info).

In Europa gibt es in
zahlreichen Städten, wie
Paris,
Brüssel und nun
Amsterdam, bereits T-30. – Der Verkehrstest auf der
Luegallee mit T-30 zeigt: Es gibt seit 1.6.23 weniger Unfälle u. große Zustimmung. (->
RP, T30 in D’dorf
hier) – Zu
Vorteilen,
Stadt-Seispielen u
. Handlungsmöglichkeiten
Bundesländer können trotzdem die Verkehrswende in drei Bereichen voranbringen.
„ 1. Entwicklung eines flächendeckenden, leistungsfähigen Umweltverbunds (Fuß, Fahrrad, ÖPNV) mit einer Mobilitätsgarantie im öffentlichen Verkehr; 2. Aufbau einer landesweit vernetzten, hochwertigen Fahrradinfrastruktur; 3. Förderung der Elektromobilität.“ (Agora 3/24)
1. Entwicklung eines flächendeckenden, leistungsfähigen Umweltverbunds (Fuß, Fahrrad, ÖPNV) mit einer Mobilitätsgarantie im öffentlichen Verkehr; 2. Aufbau einer landesweit vernetzten, hochwertigen Fahrradinfrastruktur; 3. Förderung der Elektromobilität.“ (Agora 3/24)
Vorteile von Tempo 30 laut Städteinitiative „Die Straßen werden wesentlich sicherer, gerade für die besonders Gefährdeten, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bzw. mobilitäts-eingeschränkt sind.
Die Straßen werden leiser – und das Leben für die Menschen (…} an diesen Straßen deutlich angenehmer und gesünder.
Bei Gewährleistung eines guten Verkehrsflusses kann auch die Luft in den Straßen sauberer werden (…).
Die Straßen gewinnen ihre Funktion als multifunktionale Orte zurück, die mehr sind als Verbindungen.
Und schließlich: die Straßen werden wieder lesbarer, Regeln einfacher und nachvollziehbarer (kein Flickenteppich mehr), das Miteinander wird gestärkt, der Schilderwald gelichtet.“
„Die Straßen werden wesentlich sicherer, gerade für die besonders Gefährdeten, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bzw. mobilitäts-eingeschränkt sind.
Die Straßen werden leiser – und das Leben für die Menschen (…} an diesen Straßen deutlich angenehmer und gesünder.
Bei Gewährleistung eines guten Verkehrsflusses kann auch die Luft in den Straßen sauberer werden (…).
Die Straßen gewinnen ihre Funktion als multifunktionale Orte zurück, die mehr sind als Verbindungen.
Und schließlich: die Straßen werden wieder lesbarer, Regeln einfacher und nachvollziehbarer (kein Flickenteppich mehr), das Miteinander wird gestärkt, der Schilderwald gelichtet.“
Verkehrsberuhigung in Düsseldorf und Paris
Im „
Luftreinhalteplan Düsseldorf“ (2022) wird auf belasteten Straßen T-30 empfohlen, aber durch Begrenzung auf Unfallschwerpunkte und „sensible Bereiche“ (->
OVA-Beschluss) entsteht ein Flicken-Teppich von verkehrsberuhigten Zonen, so
B. Höfer (BUND). Deshalb haben wir unsere
Kampagne „Vision Düsseldorf – Tempo runter, Leben rauf“ gestartet. In der Innenstadt von
Halle (Westf.) wird T-30 (nur) als Verkehrsversuch umgesetzt, dieie Umwelthilfe fordert ein T-30-Limit in allen deutschen Städten (
DUH, 28.10.21), u.a. mit Bezug auf die positiven Erfahrungen in
Brüssel, in
spanischen und französischen Städten, im Besonderen
Paris.
In Frankreich gilt in 200 Gemeinden Tempo 30 – seit September ’21 in Paris

Das Konzept einer Stadt der kurzen Wege mit Tempo 30 in der ganzen Innenstadt (ohne Hauptverkehrsachsen wie die Champs-Élysées) wurde von der
Bürgermeisterin Anne Hidalgo eingeführt, für sicheren Rad- und Fußverkehr und für den Lärmschutz (dadurch – 3 Dezibel).
Seit 2003 gibt es bereits etwa 200 Gemeinden mit innerstädtischem T-30, z.B. Grenoble und Toulouse. (->Autofreie Städte)
Je höher das Tempo, desto höher das Unfallrisiko

Zu nebenstehender Grafik gilt folgende Erkenntnis:
„Tempo 30 rettet Leben. Kollidieren Autos mit Fußgängern, ist das Sterberisiko bei Tempo 50 vier- bis fünfmal höher als bei Tempo 30. In 200 französischen Städten sind seit Einführung von Tempo 30 vor drei Jahren 70 Prozent weniger Menschen auf den Straßen innerorts ums Leben gekommen, zeigen erste Analysen, und auch in Brüssel gab es weniger Verkehrstote. In Oslo und Helsinki starb dank Tempo 30 in der Innenstadt im Jahr 2019 kein einziger Fußgänger oder Radfahrer an den Folgen eines Verkehrs-Unfalls. »Vision Zero« heißt dieses Ziel, keine Toten im Straßenverkehr.“ (
spectrum.de) Ein erklärender Film dazu beim ->
Umweltbundesamt.
Aber in Deutschland ist Verkehrsberuhigung selbst
für einzelne Straßen an strenge Auflagen gebunden: häufige Unfälle, Abschnitte von 300m an „sensiblen Einrichtungen“ wie Krankenhäuser, Schulen oder gesundheitsgefährdender Verkehrslärm (über 65 db tags, ein Wert, der laut
WHO bei 53 db liegen sollte). So kann oft erst nach schweren Unfällen T-30 angeordnet werden – ein Zynismus.
U ntersuchungen zur Wirkung von Verkehrsberuhigung
ntersuchungen zur Wirkung von Verkehrsberuhigung
Zu den Wirkungen sagt J. Rech, Geschäftsführer der Umwelthilfe:
„I
mmer mehr Länder gehen voran und beweisen, dass Tempo 30 innerorts nicht nur die Zahl und Schwere der Verkehrsunfälle reduziert, sondern auch die Lärmbelastung senkt, die Luftqualität verbessert und die Lebensqualität erhöht. In unserem Nachbarland Frankreich gilt Tempo 30 schon seit 2020 in 200 Städten und hat dort zu 70 Prozent weniger tödlichen Unfällen geführt. (DUH, 19.05.21)
Laut
Studie des Instituts für Urbanistik (7/23) verringert sich der Verkehr deutlich, „bei gesamten Innen-Städten zwischen 25 und 69 %, im Umfeld einzelner umgestalteter Straßen zwischen 4 und 52 %“. (S. 10).

Eine
Analyse des Deutschen Instituts für Urbanistik nennt die zentrale These im Titel: „Verkehrsberuhigung statt Kollaps“ durch Maßnahmen zur Entschleunigung des Verkehrs. Darin werden Orte mit flächenhafter u. straßen-bezogener Verkehrsberuhigung ausgewertet, wie Barcelona (Bild re.) u. Pontevedra in Spanien (dort ca 69 % weniger Kfz-Verkehr) und auf Straßen bei uns, u.a. in Hamburg u. Bremen.
F ast alle Erhebungen zeigen, dass sich der Verkehr nach der Umgestaltung verringert:
ast alle Erhebungen zeigen, dass sich der Verkehr nach der Umgestaltung verringert: „Die Größenordnung (…) liegt in den analysierten flächenhaften Verkehrs-Beruhigungsprojekten zwischen 15 und 28 %, bei gesamten Innenstädten zwischen 25 und 69 %, im Umfeld umgestalteter Straßen zwischen 4 und 52 %. (…) Es werden andere Ziele gewählt, weniger wichtige Fahrten unterlassen (…), und der befürchtete Verkehrskollaps bleibt in fast allen Fällen aus.“ (Grafik li.) Und wenig überraschend: Je attraktiver Fuß- und Radwege sind, desto häufiger nutzen Menschen sie.“
Initiativen und Organisationen fordern Tempolimits in Stadt und auf Autobahn
Ein zivilgesellschaftliches
Bündnis aus
DUH, BUND, VCD, ACE u.a. fordert die Einführung von Tempo 30 innerorts, unterstützt auch vom
Deutschen Städtetag – für Umweltschutz und lebenswerte Städte:
Der gewerkschaftsnahe Autoclub Europa (
ACE) unterstützt T-30 in Städten für die
Vision Zero, Unterstüützung auch von der Gewerkschaft der Polizei, der GEW sowie von vielen Wissenschaftler;
 Die Polizei-Gewerkschaft
Die Polizei-Gewerkschaft fordert in einem 35-seitigen Papier ein generelles Tempolimit von 30 km/h in Ortschaften – Zieldabei ist mehr Sicherheit für alle:
„50 Kilometer pro Stunde als Regelgeschwindigkeit wird den Anforderungen an den Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer nicht gerecht. Der Rückgang von tödlichen und schwersten Verletzungen hängt deshalb sehr stark davon ab, ob es gelingt, auch den innerstädtischen Verkehr weiter zu entschleunigen.“ (RP,10.02.21)
Auch der
OB von Freiburg, M. Horn, fordert in einem Modellversuch T-30 für die Innenstadt; so soll Freiburg „Deutschlands erste gesamtstädtische Modellkommune für Tempo 30 werden“. (->
Video)
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in NRW fordert in ihrem Nachhaltigkeits-Programm Tempo 30 innerorts und Tempo 120 auf Autobahnen; das Zukunftsziel ist dabei ein klimaneutraler Alltagsverkehr. Das Tempolimit auf Autobahnen wird auch von der Mehrheit der Befragten in Deutschland unterstützt, so der ARD-Deutschlandtrend vom 10.6.21.
 DUH, „Bürgerrat Klima“ und Bürger fordern Tempolimit auf Autobahnen, die Auto-Industrie und FDP-Lindner verhindern dies.
DUH, „Bürgerrat Klima“ und Bürger fordern Tempolimit auf Autobahnen, die Auto-Industrie und FDP-Lindner verhindern dies.
Eine Mehrheit befürwortet eine rasche Umsetzung des Tempolimits auf Autobahnen, T-130 unterstützen je nach Umfrage mehr als 50% der Befragten (54% beim ADAC). Auch der Bürgerrat Klima, ein Gremium aus 160 zufällig ausgewählten Bürger*innen, fordert in einem Gutachten für die Regierung ein Tempolimit auf Autobahnen.
„Wir werden ein Tempolimit von 130 km/h auf Bundesautonahnen einführen“, so das Zukunfts-Programm der SPD von 2021 (
taz, 8.1.24). Aber der erfolgreiche
Lobbyismus der ehemaligen Bundespolitiker bei den Autofirmen („Drehtür-Effekt“) und Verkehrsminister
Lindner (
Lobbyist für
Porsche) verhinderten, dass die naheliegende Forderung zugunsten des Klimaschutzes umgesetzt wurde. Die Autoindustrie dankte dies mit ca 17 Millionen
Parteispenden seit 2009, vor allem an CDU und FDP.
Die Umwelthilfe klagte erfolgreich gegen das „
gesetzeswidrige Programm“ der Bundesregierung zum Klimaschutz, fordert einen früheren Ausstieg aus dem Verbrennermotor, zudem ein Ende der „Klimakiller-Subventionen“ (
DUH, 05.09.22).
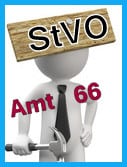
 In Europa gibt es in zahlreichen Städten, wie Paris, Brüssel und nun Amsterdam, bereits T-30. – Der Verkehrstest auf der Luegallee mit T-30 zeigt: Es gibt seit 1.6.23 weniger Unfälle u. große Zustimmung. (->RP, T30 in D’dorf hier) – Zu Vorteilen, Stadt-Seispielen u. Handlungsmöglichkeiten
In Europa gibt es in zahlreichen Städten, wie Paris, Brüssel und nun Amsterdam, bereits T-30. – Der Verkehrstest auf der Luegallee mit T-30 zeigt: Es gibt seit 1.6.23 weniger Unfälle u. große Zustimmung. (->RP, T30 in D’dorf hier) – Zu Vorteilen, Stadt-Seispielen u. Handlungsmöglichkeiten![]() 1. Entwicklung eines flächendeckenden, leistungsfähigen Umweltverbunds (Fuß, Fahrrad, ÖPNV) mit einer Mobilitätsgarantie im öffentlichen Verkehr; 2. Aufbau einer landesweit vernetzten, hochwertigen Fahrradinfrastruktur; 3. Förderung der Elektromobilität.“ (Agora 3/24)
1. Entwicklung eines flächendeckenden, leistungsfähigen Umweltverbunds (Fuß, Fahrrad, ÖPNV) mit einer Mobilitätsgarantie im öffentlichen Verkehr; 2. Aufbau einer landesweit vernetzten, hochwertigen Fahrradinfrastruktur; 3. Förderung der Elektromobilität.“ (Agora 3/24)
 Das Konzept einer Stadt der kurzen Wege mit Tempo 30 in der ganzen Innenstadt (ohne Hauptverkehrsachsen wie die Champs-Élysées) wurde von der Bürgermeisterin Anne Hidalgo eingeführt, für sicheren Rad- und Fußverkehr und für den Lärmschutz (dadurch – 3 Dezibel).
Das Konzept einer Stadt der kurzen Wege mit Tempo 30 in der ganzen Innenstadt (ohne Hauptverkehrsachsen wie die Champs-Élysées) wurde von der Bürgermeisterin Anne Hidalgo eingeführt, für sicheren Rad- und Fußverkehr und für den Lärmschutz (dadurch – 3 Dezibel). Zu nebenstehender Grafik gilt folgende Erkenntnis:
Zu nebenstehender Grafik gilt folgende Erkenntnis: ntersuchungen zur Wirkung von Verkehrsberuhigung
ntersuchungen zur Wirkung von Verkehrsberuhigung Eine Analyse des Deutschen Instituts für Urbanistik nennt die zentrale These im Titel: „Verkehrsberuhigung statt Kollaps“ durch Maßnahmen zur Entschleunigung des Verkehrs. Darin werden Orte mit flächenhafter u. straßen-bezogener Verkehrsberuhigung ausgewertet, wie Barcelona (Bild re.) u. Pontevedra in Spanien (dort ca 69 % weniger Kfz-Verkehr) und auf Straßen bei uns, u.a. in Hamburg u. Bremen. F
Eine Analyse des Deutschen Instituts für Urbanistik nennt die zentrale These im Titel: „Verkehrsberuhigung statt Kollaps“ durch Maßnahmen zur Entschleunigung des Verkehrs. Darin werden Orte mit flächenhafter u. straßen-bezogener Verkehrsberuhigung ausgewertet, wie Barcelona (Bild re.) u. Pontevedra in Spanien (dort ca 69 % weniger Kfz-Verkehr) und auf Straßen bei uns, u.a. in Hamburg u. Bremen. F ast alle Erhebungen zeigen, dass sich der Verkehr nach der Umgestaltung verringert:
ast alle Erhebungen zeigen, dass sich der Verkehr nach der Umgestaltung verringert:  Die Polizei-Gewerkschaft fordert in einem 35-seitigen Papier ein generelles Tempolimit von 30 km/h in Ortschaften – Zieldabei ist mehr Sicherheit für alle:
Die Polizei-Gewerkschaft fordert in einem 35-seitigen Papier ein generelles Tempolimit von 30 km/h in Ortschaften – Zieldabei ist mehr Sicherheit für alle: DUH, „Bürgerrat Klima“ und Bürger fordern Tempolimit auf Autobahnen, die Auto-Industrie und FDP-Lindner verhindern dies.
DUH, „Bürgerrat Klima“ und Bürger fordern Tempolimit auf Autobahnen, die Auto-Industrie und FDP-Lindner verhindern dies.







